Hallo zusammen,
nachdem der Thread von der eher technischen Seite „Kraftstoffverbrauch“ bei der allgemeinen BWL angelangt ist, gebe ich gerne auch meinen Senf dazu ab.
Meine Perspektive ist die eines reinen Spediteurs ohne eigenen Fuhrpark, der mit einer Reihe von Frachtführern bzw. Speditionen mit Selbsteintritt unterschiedlicher Betriebs- und Fuhrparkgröße zusammenarbeitet und dadurch täglich einen Eindruck davon bekommt, wie verschieden diese in Disposition und Fuhrparkmanagement aufgestellt sind.
Entscheidend für die Profitabilität ist meiner Meinung nicht die pure Größe, sondern die optimale Betriebsgröße
.
Gut laufende Betriebe haben häufig eine Größe von 10-15 LKW’s, 1 Disponent (oft noch Chef selbst) der den Laden im Griff hat plus für’s Administrative eine Angestellte (die nicht selten in Personalunion die Gattin vom Chef ist;-). Wenn der jetzt anfängt den Fuhrpark auszubauen und er braucht einen zweiten Disponenten etc. dann hat er die erwähnten „sprungfixen Kosten“, muß eventuell um Fuhrpark und Overhead auszulasten Geschäft annehmen, was er sonst nicht annehmen würde und ob der „Zweitdisponent“ dann genauso profitabel disponiert wie „Chef“ oder Altdisponent ist zweifelhaft.
Kritisch sehe ich oft die Mittelgroßen mit einem Fuhrpark von +/- 50 Fahrzeugen , mehreren Disponenten und ein paar Leute in der Verwaltung: Da habe ich bei dem einen oder anderen den Eindruck, in der Dispo weiß die linke Hand nicht oft nicht wirklich was die rechte tut und der Fuhrpark wird zwar „beschäftigt“, aber ich frage mich ob da was verdient ist. Da frisst die Ineffizienz vom großen Apparat eventuelle „Skaleneffekte“ auf.
Richtig „Skaleneffekte“ sehe ich dann bei Großfrächtern mit mehreren 100 LKW’s, die auf Standardgeschäft setzen: Da bringt Einkaufmacht, durchorganisierte Prozesse, IT etc. dann wirklich was….
Ein bisschen „off topic“ abseits vom Kraftstoffverbrauch, aber die Diskussion im Thread ist mittlerweile ja wie üblich ein bisschen vom Kernthema weg
nachdem der Thread von der eher technischen Seite „Kraftstoffverbrauch“ bei der allgemeinen BWL angelangt ist, gebe ich gerne auch meinen Senf dazu ab.
Meine Perspektive ist die eines reinen Spediteurs ohne eigenen Fuhrpark, der mit einer Reihe von Frachtführern bzw. Speditionen mit Selbsteintritt unterschiedlicher Betriebs- und Fuhrparkgröße zusammenarbeitet und dadurch täglich einen Eindruck davon bekommt, wie verschieden diese in Disposition und Fuhrparkmanagement aufgestellt sind.
Entscheidend für die Profitabilität ist meiner Meinung nicht die pure Größe, sondern die optimale Betriebsgröße
.
Gut laufende Betriebe haben häufig eine Größe von 10-15 LKW’s, 1 Disponent (oft noch Chef selbst) der den Laden im Griff hat plus für’s Administrative eine Angestellte (die nicht selten in Personalunion die Gattin vom Chef ist;-). Wenn der jetzt anfängt den Fuhrpark auszubauen und er braucht einen zweiten Disponenten etc. dann hat er die erwähnten „sprungfixen Kosten“, muß eventuell um Fuhrpark und Overhead auszulasten Geschäft annehmen, was er sonst nicht annehmen würde und ob der „Zweitdisponent“ dann genauso profitabel disponiert wie „Chef“ oder Altdisponent ist zweifelhaft.
Kritisch sehe ich oft die Mittelgroßen mit einem Fuhrpark von +/- 50 Fahrzeugen , mehreren Disponenten und ein paar Leute in der Verwaltung: Da habe ich bei dem einen oder anderen den Eindruck, in der Dispo weiß die linke Hand nicht oft nicht wirklich was die rechte tut und der Fuhrpark wird zwar „beschäftigt“, aber ich frage mich ob da was verdient ist. Da frisst die Ineffizienz vom großen Apparat eventuelle „Skaleneffekte“ auf.
Richtig „Skaleneffekte“ sehe ich dann bei Großfrächtern mit mehreren 100 LKW’s, die auf Standardgeschäft setzen: Da bringt Einkaufmacht, durchorganisierte Prozesse, IT etc. dann wirklich was….
Ein bisschen „off topic“ abseits vom Kraftstoffverbrauch, aber die Diskussion im Thread ist mittlerweile ja wie üblich ein bisschen vom Kernthema weg

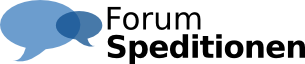

 , nach ein paar Antworten gleiten die Themen ins OT ab.
, nach ein paar Antworten gleiten die Themen ins OT ab.
